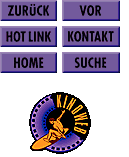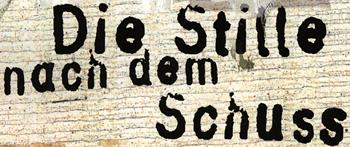
Unterstützen Sie Kinoweb. Klicken Sie unseren Sponsor.
Die Stille nach dem Schuss

Produktionsnotizen
Ein Gespräch mit Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase und Regisseur Volker Schlöndorff* Was hat Sie auf die Idee gebracht, die Geschichte einer bundesdeutschen Terroristin, die in der DDR untertaucht, festzuhalten?
Kohlhaase: Es stand in der Zeitung damals, 1990, dass in der DDR westdeutsche Terroristen verhaftet wurden. Es wurde über ihren Hintergrund in der RAF berichtet und unter welchen Umständen, Namen und Identitäten sie später in der DDR lebten. Innerhalb einiger Wochen wurden an die 10 Personen verhaftet, übrigens noch in Zuständigkeit der DDR und von der Volkspolizei. Man versuchte es wie eine Fahndung aussehen zu lassen.
* Und das hat Sie dann zu einer Geschichte inspiriert?
Kohlhaase: Geschichten haben Vorgeschichten. Es gab die Nazi-Zeit, den 2. Weltkrieg, die Niederlage, die Teilung Deutschlands und den kalten Krieg. Vor diesem Hintergrund stehen die Lebensläufe der Terroristen. Sie sind ja nicht aus irgendeiner Kiste gesprungen, sondern sie waren die Kinder ihrer Eltern. Als Volker Schlöndorff und ich über den Stoff sprachen, schien uns, dass wir aus verschiedenen Richtungen und Erfahrungen kommen, im Kino wie im Leben und gemeinsam eine deutsche Geschichte erzählen könnten.
Schlöndorff: Zuerst interessierte sich Wolfgang Kohlhaase mehr für das Leben der sogenannten Terroristen im Westen: Ihrem Weg von einer Kaufhausbrandstiftung über Anti-Vietnam-Proteste bis zum bewaffneten Kampf gegen den Staat. Ich dagegen wollte mehr über die DDR wissen: Wie kommt man zu einer Wohnung? Kann man die Arbeit wechseln? Darf man von einer Stadt in die andere umziehen? Worüber spricht man in der Kaffeepause, und solche ganz alltäglichen Dinge.
* Wie recherchiert man für ein solches Thema?
Kohlhaase: Ich habe alles gelesen, was es gab. Und ich habe mich um Gespräche mit Inhaftierten bemüht. Ich habe Susanne Albrecht, Hans-Peter Boock und Inge Viett im Gefängnis besucht. Ich wollte mit den wirklichen Personen sprechen, um Gesichtspunkte für fiktionale Personen zu finden. Ich wollte etwas finden, um etwas erfinden zu können. Die Erfindung verändert den Gegenstand.
* Aus Ihren Recherchen entstand die Figur der Rita Vogt, eine westdeutsche Terroristin, die in der DDR unter- und ins alltägliche Leben einer Arbeiterin eintaucht. Was glauben Sie war ihr Beweggrund für diesen Schritt?
Kohlhaase: Ich glaube, dass die Leute in Terrorismus irgendwann an den Punkt gekommen sind, wo sie begriffen, dass ihre Aktionen und ursprünglichen politischen Ziele nicht mehr zusammengingen. Sie steckten in einer Sinnkrise, andererseits wurden sie so kompromisslos verfolgt, dass ihnen die Rückkehr in ein bürgerlichens Leben nicht mehr möglich war. Sie sahen sich nach exotischen Orten um und dachten an die dritte Welt. Dass es dann die DDR war, wo sie ankamen, hat wohl niemand geplant oder vorausgesehen.
Schlöndorff: Den "skurrilsten Politkrimi der deutsch-deutschen Geschichte" hat es der Spiegel genannt. Ja, die Geschichte war gut, aber schwer zu erzählen. Wieviel muss ich von Ritas Vergangenheit wissen, um ihr Verhalten in der DDR zu verstehen? Sie hat es nicht als ein Eingesperrtsein empfunden. Für sie war dieses ganz normale Leben wie eine Befreiung, sie hat sogar eine Art Glück gefunden. Sie machte sich nützlich, wurde gebraucht und anerkannt. Sie hatte auf einmal Zeit für Gefühle.
* Rita versucht sich in diese Alltäglichkeit einzufinden. Lernt dabei mit Tatjana eine Frau kennen, die sich genau dagegen auflehnt. Was lässt diese beiden Frauen Freundinnen werden?
Kohlhaase: Ein Gefühl füreinander. Ein gewisser Non-Konformismus, ein Bestehen auf einer eigenen Idee von sich selbst. Sie treffen sich, weil sie Fragen an die Welt haben, wenn auch verschiedene. Für Tatjana ist Rita, die aus dem Westen in die DDR geflüchtet ist, zunächst ein Wesen von einem anderen Stern. Aber auch Rita hat sich nicht vorgestellt, dass sie die Widersprüche in ihrer Welt nun in dieser neuen und anderen Welt eintauscht gegen neue und andere Widersprüche.
Schlöndorff: Die eine will weg, die andere will ankommen. Beide mögen den Staat nicht, in dem sie geboren worden sind. Sie fliehen ihn. Typisch deutsch, auch das. Und fast immer ist die Liebe der Fluchthelfer. Rita liebt erst Andi, der Bruch mit ihm ist auch der Bruch mit dem bewaffneten Kampf.
Dann verliebt sich Tatjana in diesen freien Vogel aus dem anderen Land, und Rita entdeckt in sich eine bisher nie gekannte Zärtlichkeit. Als sie Tatjana verraten muss, aus Staatsräson sozusagen, flüchtet sie wieder ins aktive Leben, will in die Partei eintreten, macht Sozialarbeit in einem Kombinat.
Sich aufopfern und keine privaten Gefühle mehr haben, scheint sie von sich zu fordern. Da trifft sie im Sommerlager auf einen jungen Physiker, der in ihr nur eine Frau sieht. Bis dahin hat sie schon fast vergessen, dass sie keine normale Bürgerin der DDR ist, sie lebt mit einer Legende, sie ist nicht frei.
Rita erschließen sich diese Widersprüche lange nicht, sie bringt der DDR und ihrem gesellschaftlichen Konzept viel Symphatie entgegen, so wie sie von den DDR-Behörden viel Verständnis und Unterstützung erfährt. Ein Schlüsselszene dafür ist das Gespräch zwischen dem Stasi-Offizier Hull und seinem vorgesetzen General, der Revolution und Romantik in eine Beziehung setzt.
Kohlhaase: Etwas von einem solchen Traum hat sich in der DDR immer erhalten, gerade auch bei denen, die für den Sozialismus gekämpft und gelitten hatten. Dabei hat vielleicht mancher übersehen, dass er inzwischen zu einer sehr unromantischen Bürokratie gehörte. Der General sagt: "Ich träume doch immer noch, es ist doch nichts fertig." Dabei ist auch Melancholie und die stille Frage, ob die Sache überhaupt jemals fertig werden wird.
Schlöndorff: Die Haltung der alten Stasi-Leute war überraschend: Sie kamen aus dem spanischen Bürgerkrieg, aus dem Widerstand gegen Hitler, aus dem Partisanenkampf. Deswegen hatten sie "Sympathie für romantische junge Leute, die wenigstens einmal im Leben das Unmögliche versuchen wollten".
Waren sie nicht selbst Romantiker, d.h. Idealisten, die noch glaubten, durch entsprechende Maßnahmen eine bessere Welt schaffen zu können? Umso härter traf beide die Wende: Es war der Abschied von einer Utopie, die sich vielleicht verbraucht hatte, ohne die es aber für sie kein Leben gab. Deutsche Lebensläufe eben, wie es sie anderswo nicht geben konnte.
* Die Stille nach dem Schuss handelt von einer fiktiven Figur vor einem realen Hintergrund. Dennoch ist es auffällig, dass die Begriffe RAF und Stasi niemals auftauchen. Warum?
Kohlhaase: Dass mit "Behörde" nicht etwa die Post gemeint ist, sondern die Staatssicherheit, sieht wohl jeder. Wir wollten vermeiden, dass sich unser Film wie eine Folie auf die Dokumente legt. Es gab nie eine Terroristin Rita Vogt. Wir erzählen eine persönliche Geschichte, die natürlich keine private ist.
* Ihr neuer Film erscheint im Blick auf Ihr Werk wie eine Rückbesinnung; nicht nur von der Geschichte selbst her, sondern auch in der Verbindung von persönlichem Schicksal und politischer Brisanz.
Schlöndorff: Eigentlich habe ich nichts Neues zu bieten: Meine Filmografie ist wie mein Lebenslauf, viele Kurven und Umwege, viele Aufbrüche, Trennungen, immer wieder Rückkehr zur deutschen Geschichte. In den zehn Jahren, die ich jetzt in Berlin bin, hatte ich wenig Zeit zum Filmemachen. Umso mehr zum Erleben und beobachten. Das will jetzt abgearbeitet werden. Es hatte etwas befreiendes, einfach wieder so zu drehen wie früher.
* In gewisser Weise ist es ein Kostümfilm, der viel Sorgfalt in Detail erfordert. Wie recheriert man die Zeitbezüge der 80er Jahre in der DDR und worauf mussten Sie als Regisseur bei der Inszenierung achten?
Schlöndorff: Die Langeweile in der DDR, meinetwegen auch das Unrecht, kann man nicht durch die Staatsapparate oder Kulissen erzählen. Es wäre aufwendig und würde langweilen. Die Haltung der Menschen aber sagt gerade zehn Jahre danach immer noch viel. Das habe ich in Babelsberg gut beobachten können, nicht im Großen, sondern im Kleinen.
Wie man sich grüßt, wie man hinschaut oder wegschaut, und wann man lächelt. Deshalb erzählen wir das Land durch die Gesichter, die sich nicht so leicht renovieren lassen wie die Hausfassaden.
Wolfgang Kohlhaase liefert die richtigen, lakonischen Dialoge, mit den nötigen Pausen, um in die Menschen einzudringen. Sie stimmen einen traurig, sind komisch und berühren mich zutiefst. Am Ende ist keiner ganz gut oder ganz böse, es ist wie es ist, zurück bleibt die Emotion.
* Gab es Gründe auf prominente Namen in der Besetzung weitgehend zu verzichten?
Schlöndorff: Ja, es war eine Entscheidung vorweg und zum Teil aus Respekt für die Vorbilder. Es gab sie ja, die Toten, und es gibt sie noch, die überlebt haben, wenn auch in reichlich verzerrten Darstellungen. Das Klischee des sogenannten Terroristen ist ein übermächtiges. Dem ist nicht mit bekannten Schauspielern beizukommen.
Mit jungen, vollkommen unbekannten Gesichtern dagegen kann man
sie neu entdecken, dachte ich. Dasselbe gilt für die Jungen
aus der DDR. Unaufdringlich und spröde sollten sie sein,
aber lebendig, zum Anfassen, mit kräftigem Handschlag oder
liebevoller Umarmung.